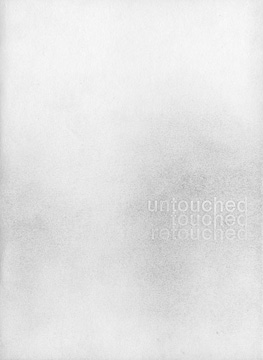
untouched
touched
retouched
Landschaften, Portraits und Screenshots
Photographien in drei Kapiteln
präsentiert in einem Buch
Vorwort von Annette Wehrmann
Im Jahr 2002 hielt sich Birgit Wudtke in Island auf, um dort die Landschaft zu fotografieren. Bei dieser Arbeit, mit der Andersheit der isländischen Landschaft konfrontiert, drängte sich ihr eine Wahrnehmung auf, die meist unbewusst bleibt: die Differenz, das Abweichen, der Unterschied zwischen dem fotografischen Abbild und der abgebildeten Realität.
Wir sind gewohnt, das Foto als ein weitgehend exaktes Abbild des Dargestellten wahrzunehmen. Das Foto kann verwackelt sein, überoder unterbelichtet, es kann falsch entwickelt oder nachbearbeitet sein, zum Beispiel einen veränderten Farbton haben. An der grundlegenden Übereinstimmung des Abbildes mit dem Abgebildeten wird aber immer noch - allen Bildbearbeitungskünsten zum Trotz - wenig gezweifelt, die Filmsequenzen der Kriegsschauplätze im Fernsehen nehmen wir immer noch als authentisch wahr, und ein fotografisches Abbild aus einer Überwachungskamera gilt als ein beweiskräftiges Mittel der Identifikation. Die visuelle Massenkultur unserer Tage beruht wesentlich auf dieser angenommenen Übereinstimmung des Fotos mit der Realität, bezieht in letzter Zeit allerdings zunehmend das Wissen um die Manipulierbarkeit dieser Bilder mit ein. Tatsächlich sind wir sogar bestrebt, die Beziehung zwischen fotografischem Abbild und Abgebildeten in ihr Gegenteil zu verkehren. Die Realität scheint sich zunehmend an fotografische Bilder anzugleichen und wir bemühen uns, wenn auch vergeblich, unsere nach Vorgabe der mit Photoshop bearbeiteten Abbildungen in den Massenmedien zu modellieren.
Bei ihrer Arbeit in der isländischen Landschaft machte Wudtke die Erfahrung, dass es ihr unmöglich war, die Farben von Moos, Flechten, Lava und vulkanischen Ablagerungen, des Himmels und des nördlichen Lichtes, die sie sah, mit dem Filmmaterial, das sie benutzte - Kodak - wiederzugeben. Das fotografische Abbild erschien ganz deutlich als das, was es eigentlich ist: das durch mehrere Stadien der Vermittlung gegangene und vergröberte Resultat der Berührung fotosensibler Oberflächen durch das Licht. Die als unberührt wahrgenommene isländische Landschaft erschien durch das Betreten, durch den Blick auf sie, irgendwie verändert zu sein, in Besitz genommen, "berührt".
Nun ist die seit 1.200 Jahren besiedelte isländische Landschaft natürlich keineswegs so unberührt, wie sie dem kontinentaleuropäischen Betrachter zunächst erscheint, sondern ein seit Jahrhunderten von Menschen genutzter Raum. In Wudtkes Bildern aus Island erscheint die Unberührtheit denn auch sowohl als Traumbild von archetypischer Eindringlichkeit als auch als Konstruktion, die immer schon von kulturellen Artefakten überlagert ist. In den ruhigen, zentral fokussierten Aufnahmen, die ein Bild naturgegebener Harmonie zu vermitteln scheinen, tauchen gelegentlich Straßen auf, Städte, Häuser oder Patronenhülsen, die den Boden eines urtümlichen Tals bedecken, und das Abbild natürlicher Unberührtheit allmählich überlagern und in eine Kulturlandschaft transformieren. Das Bild der unberührten Natur als Gegensatz der Kulturlandschaft erweist sich letztlich als Produkt eigener Sehnsüchte und Wünsche, als etwas nie gewesenes oder immer schon im Übergang begriffenes. Der Bildaufbau ist bei allen Fotos der Serie sehr ähnlich, ein zentraler Fokus, der den Eindruck meditativer Ruhe noch verstärkt. In dieser gewählten Form sieht Wudtke eigene subjektive Erfahrungen von Landschaft vermittelt, die z.B. aus prägenden Kindheitseindrücken herrühren können oder "Verweise auf vergangene Situationen geben, welche im Jetzt des Betrachtens Stimmungen der Ausgeglichenheit als auch Gefühle der Verletzung auslösen können" (Wudtke).
Auch die anderen beiden präsentierten Serien thematisieren, dem Titel "untouched touched retouched" entsprechend, Aspekte des "Unberührten", des "Berührten" und der wechselseitigen Beziehung beider Begriffe. "Retouched" verweist dabei auf die Tätigkeit in der kommerziellen Fotografie, die Birgit Wudtke ausübt, digitale Bildbearbeitung, "Retusche" von Modefotografie mittels Photoshop. Wudtkes künstlerische Fotografie steht zu dieser kommerziellen Tätigkeit in einem produktiven, wenn auch nicht reibungslosen Wechselverhältnis, etwa in der direkten Thematisierung dieses Verhältnisses in der Serie "retouching layers", aber auch in der Prägung der Sehgewohnheiten. Die Porträtfotos, die Birgit Wudtkes von von ihren Freundinnen macht, sind von diesem Wechselverhältnis deutlich beeinflusst: die abgebildeten Frauen sind "schön" - und "schön dargestellt" - wie Frauen auf Modefotos, sie weichen in ihrer Erscheinung aber deutlich von dem in diesen Medien favorisierten Frauentypus ab. Wudtkes Fotos bilden sehr intime, fast private Momente in niemals enthüllender oder spekulativer Form ab: auf den Fotografien sind Freundinnen und Geliebte von Wudtke in entspannten, ungeschützten Situationen zu sehen, z.B. im Bett oder liegend im Gras oder in den Blaubeeren. Verbindungen unter den Dargestellten, etwa eine miteinander geteilte verlängerte Adoleszenz, drängen sich auf: die meisten der Frauen sind zwischen zwanzig und dreissig Jahre alt und kennen einander. Es handelt sich aber ganz offensichtlich nicht um Darstellungen einer "Szene", "Clique" oder eines "Lebensgefühls", wie etwa in den Arbeiten von Larry Clark, Nan Goldin oder Wolfgang Tillmans, und auch nicht um die Umsetzung eines soziologischen Ansatzes. Auf einem der schönsten Fotos der Serie ist eine Matratze zu sehen, die auf einem abgeschliffenen und versiegelten Holzfußboden liegt. Auf der Matratze liegt eine mit einem großblumigen Bezug bezogene Bettdecke, darunter schauen drei Paar Füsse hervor, ein Paar Kinderfüße und zwei Paar Erwachsenenfüße. Diese Fotografie transportiert mit spürbarer Intensität gerade durch die Verhüllung, die Abwendung vom Betrachter, das Gefühl emotionaler Nähe. Vom Auge des Betrachters unberührt. Wie die Landschaftsaufnahmen vermitteln auch die Porträts einen Eindruck von Harmonie und scheinen in eine - wenn auch brüchige - Traumwelt von Kindheit, von Unberührtheit zu führen, in der Trauer und Schmerz ihren Platz haben, aber nicht mehr verletzen können. Das einzige Selbstporträt der Serie akzentuiert diese Thematik noch einmal: Birgit Wudtke verbirgt darauf ihr Gesicht hinter einem mit lustigen Tieren bedruckten Kinderkopfkissen. Nur ihre Hände, die das Kissen halten, sind von ihr zu sehen. Ein Abbild der Verletzlichkeit. Einige Bilder der Serie zeigen fast vollständig schwarze Oberflächen, auf denen minimale Lichtreflexe Abbilder von Menschen und Landschaften nahelegen. Dieses Verschwinden in der Schwärze hat jedoch nichts Bedrohliches an sich, die Todesahnungen verschmelzen mit dem Gefühl der Nähe.
In der dritten Serie verkehrt sich dieser Prozess, jede Vertrautheit, jede Nähe ist verschwunden, nur die Oberfläche ist geblieben, genauer ihre Berührung, Bildbearbeitung, aus der das Abbild entfernt wurde. Im Gegensatz zu Wudtkes Freundinnen aus der Portrait-Serie sind die Frauen, die auf den "retouching layers" irgendwie zu sehen sind, mit ihr niemals in Kontakt getreten, die "retouching layers" sind eigentlich ein Zwischenprodukt von Birgit Wudtkes kommerzieller Tätigkeit, Bildbearbeitung von Modefotografien, in der die Abbilder der Models nur als zu bearbeitendes Produkt präsent sind. Ursprünglich ein privater, verstohlener Akt des Aufbegehrens - das Anlegen einer Sammlung von Screenshots als Wiederaneignung eigener kreativer Arbeit, in Wudtkes Worten "to use the computer as my camera during my working hours" (aus ihrem Master´s Project, Kunsthøgskolen i Bergen, Norwegen) - wandelte sich die Sammlung mehr und mehr in eine Strategie künstlerischen Arbeitens am Rande der Illegitimität einerseits und einer Auseinandersetzung mit dem Menschen-, insbesondere dem Frauenbild, wie es medial erzeugt und vermittelt wird, andererseits. Darin eingeschlossen ist die Frage nach Birgit Wudtkes eigener Doppelfunktion als (Mit-)Produzentin eines stereotypisierten Frauenbildes und Agentin der gesellschaftlichen Norm zum einen und kritischer Künstlerin andererseits, die diesen Prozess der (real unmöglichen) Standardisierung reflektiert zum anderen. Deshalb lässt sich diese Arbeit auch als Auseinandersetzung mit Wudtkes persönlicher, aber auch stereotypen Problematik betrachten, die die kommerzielle Arbeit in einer von Männern dominierten Branche, die vorrangig sexistische Gender-Stereotypen produziert, für Frauen mit sich bringt. Tatsächlich lässt sich an den "retouching layers" das ganze Ausmaß des virtuellen Facelifting, das in dieser Branche Standard ist, ablesen. Durch das Weglassen oder Entfernen des ursprünglichen Bildes bleiben die layers, also die Bearbeitungsebene, als Zerrbilder zurück und bilden eine eigene Ästhetik aus, die mit der Ästhetik der Vorlagen nichts mehr zu tun hat. Inwieweit sich an den jeweiligen layers persönliche ästhetische Vorlieben Wudtkes ablesen lassen, ist schwer zu beantworten, da die Arbeitsschritte an genaue Vorgaben gebunden sind. Es sind Ausschnitte aus einem Arbeitsprozess zu sehen, Zwischenschritte, die als eigenständige Bilder nicht intendiert waren und durch eine intentionale, aber letztlich willkürliche Wahl ausgewählt wurden. Aus ihrem eigentlichen Kontext herausgenommen und nebeneinander gestellt, zeigen diese ästhetischen Zwischenformen das Bild einer eigentümlichen Leere, Unfertigkeit, die sich wie ein sarkastischer Kommentar zu den letztlichen Endprodukten von Wudtkes kommerziellen Aufträgen, den Modefotografien, liest.

back